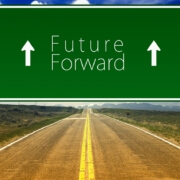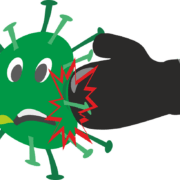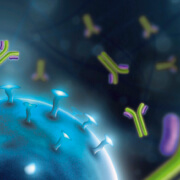Warum hat die Naturheilkunde eine günstige Zukunft?
In den letzten 40 Jahren hatte die Naturheilkunde infolge vielfältiger gesundheitspolitischer Einflüsse in Deutschland einen schweren Stand. Die folgenden Ausführungen stellen die Entwicklung aus meiner Sicht und sehr verkürzt dar. Eine exakte historische Aufarbeitung vor allem der letzten zwanzig Jahre wäre sehr wünschenswert.
Die Entwicklung der verschiedenen Säulen der Naturheilkunde in der Bundesrepublik Deutschland
Nach der Teilung Deutschlands 1949 entwickelte sich das Gesundheitswesen der beiden deutschen Staaten sehr unterschiedlich. Die Bundesrepublik Deutschland war ab den 1950er Jahren die Apotheke der Welt, hier hatten damals mehrere große Pharmahersteller ihren Sitz. Der Contergan-Skandal gegen Ende der 1950er Jahre führte im Jahr 1965 zur Verabschiedung des ersten Arzneimittelgesetzes. Diese Gesetze sollen insbesondere dem Patientenschutz dienen und regeln unter anderen die Durchführung von klinischen Studien. Im Vergleich zu anderen Industrienationen wurden diese Gesetze in Bundesrepublik aber erst sehr spät entwickelt. Dadurch konnten hier noch in den 1980er Jahren Arzneimittelprüfungen ohne umfangreiche Auflagen durchgeführt werden, dies war in anderen Ländern längst nicht mehr möglich. Deshalb waren sie auch Schwerpunkt der medizinischen Forschung an den deutschen Universitätskliniken. Naturheilverfahren standen dagegen nicht im Fokus, da sie schon damals schlecht vergütet wurden und zudem Patentierungen kaum möglich waren.
Im Rahmen der zweiten Arzneimittelnovelle von 1976 wurden Phytopharmaka, Homöopathika und Arzneimittel der anthroposophischen Medizin in der Kategorie „Besondere Therapierichtungen“ zusammengefasst. Sie mussten im Gegensatz zu den chemisch definierten Arzneimitteln für ihre Nachzulassung keine Wirksamkeitsbelege in Form von klinischen Studien erbringen. Im Auftrag der deutschen Zulassungsbehörde, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, wurde aber das wissenschaftliche Erkenntnismaterial für die verschiedenen Arzneipflanzen systematisch in Form von Monographien zusammengestellt. Diese Arbeit wurde weltweit zum Vorbild für wissenschaftliche Monographien von Arzneipflanzen, u.a. für die Erstellung der Monographien der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) ab 2004. Bis Anfang der 1990er Jahre verloren dagegen alle damals im Markt befindlichen Arzneimittelkombinationen aus chemisch definierten Substanzen und Arzneipflanzenextrakten ihre Zulassung, da sie die Auflage des Nachweises der Wirksamkeit in klinischen Studien nicht erfüllen konnten.
Die Bewegungstherapie stand in den Jahren seit ca. 1960 nicht besonders im Fokus. Gut erinnerlich sind mir Aktionen für die Bevölkerung wie Trimm-Dich-Pfade ab den späten 1970ern, später Laufsport einschließlich Joggen und Marathonlauf. An den Sporthochschulen befasste man sich vor allem mit Leistungssport, in der medizinischen Aus- und Weiterbildung wurde Bewegung als Komponente von Therapiekonzeptionen kaum thematisiert. In den Kurorten und –kliniken standen vor allem passive Verfahren wie Massagen im Fokus.
Immer weiter verschärfte Hygieneauflagen und schlechte Vergütung durch die Gesetzlichen Krankenversicherungen führten dazu, dass in den Akutkliniken die Abteilungen für Physikalische Therapie ab Ende der 1960er Jahre verkleinert oder sogar abgeschafft wurden. Betroffen waren insbesondere die Hydro- und Balneotherapie, die damit nur noch in den zumeist privat geführten Kurkliniken und in den Heilbädern und Kurorten als Heilmittel verwendet wurde und ansonsten der Selbstanwendung vorbehalten war.
Eine gesunde Ernährung spielte noch bis Anfang der 2000er Jahre bei der ärztlichen Aus- und Weiterbildung und im Akutkrankenhaus keine Rolle. Auch danach setzte man eher auf medikamentöse Therapien bei durch Fehl- oder Überernährung bedingten Erkrankungen als auf deren Prävention.(wie ist das heute? Ist (gesunde) Ernährung Lehrfach?)Vielmehr führte die seit den späten 1980er Jahren in den USA propagierte kohlenhydratreiche, fettarme Kost auch zu einem starken Anstieg der Adipositasrate in der deutschen Bevölkerung. Gesetzliche Krankenversicherungen übernahmen in der Regel die Kosten in spezialisierten, u.a. naturheilkundlich orientierten Kur- und Fastenkliniken nur bis 1990, bei der Ernährungsberatung wurden nur Programme im Sinne der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gegenfinanziert.
Die Entwicklung der Ordnungstherapie in dieser Zeit ist in ihrer Komplexizität kaum darstellbar. Noch bis Anfang der 2000er Jahre wurde in Akutkliniken einschließlich der Universitätskliniken nur selten eine psychologische Betreuung angeboten, auch Mind-Body-Medicine und Entspannungsverfahren wie autogenes Training oder progressive Relaxation, Yoga oder Qigong waren nicht etabliert. Gleichzeitig boomten im Rahmen der New-Age-Bewegung seit Ende der 1960er Jahre esoterische Angebote. Hier sind beispielsweise angeblich speziell aufbereitetes gesundheitsförderndes Trinkwasser, heilende (Halb-)edelsteine, teure pseudopsychologische Wochenendseminare sowie eine vielfältige Ratgeberliteratur zu nennen. Es war die Zeit des positiven Denkens, der Wunderheiler, Gurus und Sekten. Aus heutiger Sicht werden auch viele sozialpsychologische Untersuchungen, die bis Anfang der 2010er Jahre durchgeführt wurden und deren Ergebnisse bei vielen Lifecoaches bis heute populär sind, als wissenschaftlich zumindest umstritten angesehen.
Naturheilkunde in der DDR, Entwicklung des zweiten Gesundheitsmarktes
In der Deutschen Demokratischen Republik wurde die Abschaffung der Heilpraktiker, die bekanntlich 1939 gesetzlich fixiert worden war, unverändert fortgesetzt. Dagegen wurden die Ärzte für Physiotherapie etabliert, die allerdings nur über ein beschränktes, staatlich vorgegebenes Therapiespektrum verfügten, das sich vorwiegend auf die Physikalische Medizin erstreckte. Dieser Facharzt wurde nach der Wiedervereinigung Deutschlands abgeschafft und 1994 durch den fachlich wesentlich breiter aufgestellten Arzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation ersetzt. Wegen der hohen Kosten der Wiedervereinigung wurden in dieser Zeit auch die gesetzlichen Grundlagen für eine weitreichende Veränderung Deutschlands im Sinne des Neoliberalismus gelegt, u.a. wurde die Privatisierung von vielen Bereichen der Grundversorgung der Bevölkerung einschließlich des Gesundheitswesens ermöglicht. Um Kosten einzusparen, fielen in dieser Zeit deshalb z. B. nahezu alle naturheilkundlichen und komplementärmedizinischen Therapien aus der Erstattungsfähigkeit durch die Gesetzlichen Krankenversicherungen heraus, das Schlusslicht dieser Entwicklung bildeten die Phytopharmaka im Jahr 2004. Das hohe Bedürfnis der Bevölkerung nach diesen nebenwirkungsarmen Therapieverfahren wurde in den sich ab Ende der 1990er Jahre allmählich sich entwickelnden, ökonomisch orientierten zweiten Gesundheitsmarkt, d.h. dem Selbstzahlermarkt, kanalisiert. Daraus resultierte ab den späten 1990er Jahren eine Blüte des Gesundheits- und Wellnesstourismus, wodurch die nach der Reha-Krise von 1996 darniederliegenden Heil- und Kurbäder allmählich wiederbelebt wurden. Hier wurden, oft ohne wahrnehmbare Qualitätssicherung, vor allem passive Verfahren aus der Naturheilkunde und außereuropäischen traditionellen Medizinsystemen, wie z. B. verschiedene Massageverfahren und Bäder ohne Indikationsbezug vermarktet.
Entwicklung des ersten Gesundheitsmarktes
Im von der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) gegenfinanzierten ersten Gesundheitsmarkt finden sich vor allem diejenigen Diagnostik- und Therapieverfahren, die wegen ihrer Nebenwirkungen ärztlich verordnet werden müssen. Wirksamkeitsbelege im Sinne der evidenzbasierten Medizin haben bei dieser Zuordnung in den 1990er Jahren kaum eine Rolle gespielt. Dieses in dieser Zeit ursprünglich ausschließlich für die Bewertung der Wirksamkeit von chemisch definierten Pharmaka entwickelte Konzept wurde zunehmend auch auf die nicht medikamentösen Verfahren ausgedehnt. In der Hoffnung, dass dieser personalintensive Bereich auf die Dauer durch Medizinprodukte ersetzt werden könnte, wurde deren Entwicklung mit öffentlichen Fördermitteln ab Mitte der 1990er Jahre stark unterstützt. Infolgedessen entwickelte sich Deutschland zu einer in der Medizinproduktentwicklung führenden Nationen weltweit, zumal zunächst keine kostenintensiven klinischen Prüfungen, ja nicht einmal Registrierungen im Sinne des Patientenschutzes vorgeschrieben waren. Erst ab dem Problem der geplatzten Brustimplantate von 2013 wurden allmählich den Arzneimittelprüfungen angepasste Prüfungen für Medizinprodukte sowie Register z. B. für Endoprothesen in Deutschland entwickelt.
Im Bereich der Rehabilitationsmedizin, in der traditionell viele naturheilkundliche Verfahren angewendet wurden, wurden von der Deutschen Rentenversicherung ab 2004 Rehabilitationsrichtlinien eingeführt. Die Ableistung der übrigens bis heute wenig evidenzbasierten Behandlungsmodule, vor allem in ihrer jeweiligen Kombination, ist bei jeder Erkrankung genau vorgeschrieben, bei Nichteinhaltung wird die Fallpauschale nicht gezahlt. Naturheilkundliche und komplementärmedizinische Therapieverfahren werden in diesen Richtlinien bisher nahezu nicht berücksichtigt, auch wenn sie bei bestimmten Erkrankungen in den medizinischen Leitlinien inzwischen empfohlen werden.
Außereuropäische Verfahren und andere Konkurrenten
Ab den 1980er Jahren nahm die Bedeutung traditioneller außereuropäischer Verfahren für die Therapie von Krankheiten außerhalb der etablierten Medizin immer mehr zu. Diese Verfahren drangen teilweise auch bis in die medizinische Forschung vor, wobei die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) infolge der massiven finanziellen Unterstützung durch die Volksrepublik China (VR) weltweit zum Wegbereiter wurde. In den 1990er Jahren wurde deshalb in den USA eine Abteilung des National Health Institute (NIH) geschaffen, die sich nur mit traditionellen und komplementären Verfahren befasste, Forschungsgelder vergab und für die flächendeckende Einrichtung von entsprechenden Lehrstühlen an den Universitäten sorgte. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelte sehr bald dieses Vorgehen in Strategievorschlägen hinsichtlich der Etablierung von traditionellen und komplementären Therapieverfahren in ihren Mitgliedsländern weiter. Leider gehören bis jetzt die meisten Mitgliedsländer der EU einschließlich Deutschlands bei der Umsetzung dieser Vorschläge zu weltweiten Schlusslichtern.
Infolge der finanziellen Förderung durch die VR von z. B. Forschungsprojekten u.a. in Deutschland und Einladungen deutscher Medizinstudierender nach China wurden auch in Deutschland insbesondere die Verfahren der TCM populär. Das damit von der VR im Hintergrund verfolgte Ziel, im lukrativen europäischen Arzneimittelmarkt mit chinesischen Pharmaka Fuß zu fassen, war damals nur einem kleinen Personenkreis bekannt. Die entsprechend der ärztlichen Approbationsordnung von mir in Rostock ab 2003 organisierte Pflichtvorlesung zum Querschnittsbereich 12 (Rehabilitation, physikalische Therapie, Naturheilverfahren) war zunächst sehr schwach besucht, es gab sogar Beschwerden der Studierenden, dass Verfahren der TCM nicht berücksichtigt wurden. Dies hat sich jedoch im Verlauf der Jahre mit zunehmender Aufklärung der Studierenden über die Hintergründe der TCM stark geändert. Dafür positionieren sich als Konkurrenz zu den Naturheilverfahren seit etlichen Jahren vor allem in den östlichen Bundesländern immer mehr die Vertreter der Manuellen Medizin, die sich anfänglich aus den Ärzten für Physiotherapie rekrutierten. Nachdem bei den zunächst im Vordergrund stehenden finanziell lukrativen chirotherapeutischen Eingriffen deren erhebliche Nebenwirkungen publik wurden, wurden im Laufe der Jahre neben einer immer aufwändigeren Diagnostik gleichzeitig etliche komplementärmedizinische Verfahren wie z. B. Osteopathie, Kraniosakraltherapie, Schröpfen, Neuraltherapie und Akupunktur/Akupressur angewendet, um die Wirkung der manuellen Behandlung zu verstärken. Insbesondere selbstzahlende Schmerzpatienten werden damit versorgt, die Belege für eine insbesondere nachhaltige Wirksamkeit sind allerdings bisher mehr als dürftig.
Evidenzbasierung und Leitlinien
Die Umsetzung von Wissenschaftstheorien und die Schulung von medizinischem Personal in den Grundlagen der Statistik hat zu einer rasanten Entwicklung der evidenzbasierten Medizin seit den 1990er Jahren geführt. Dies ermöglichte zunehmend den Ersatz von Lehrmeinungen durch wissenschaftlich absicherte medizinische Leitlinien. Diese enthalten zwar noch immer viele lediglich empirisch gestützte Empfehlungen, dies wird aber kenntlich gemacht, wodurch Forschungsdefizite systematisch identifiziert werden. Da zu den Naturheilverfahren wegen fehlender entsprechender Lehrstühle und Forschungsfinanzierung in der Regel allenfalls ältere klinische Studien existierten, die aber nicht mehr den neueren Prüfstandards entsprachen und auch in der Regel nicht in international zugänglichen Zeitschriften publiziert worden waren, kam in Deutschland das sich bis heute hartnäckig haltende falsche Gerücht auf, dass die Wirksamkeit von Naturheilverfahren nicht belegt und sie deshalb unwirksam seien. Wegen der durch internationale Forschungsaktivitäten verbesserten Evidenzlage wurden jedoch 2013 die Gesellschaft für Phytotherapie und 2018 die Deutsche Gesellschaft für Naturheilkunde in die Arbeitsgemeinschaft der Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) aufgenommen. Seither können Vertreter beider Fachgesellschaften qualifizierte Empfehlungen von naturheilkundlichen und komplementärmedizinischen Therapieverfahren in geeigneten Leitlinien positionieren. Da inzwischen auch PatientInnen an der Leitlinienentwicklung beteiligt sind, nimmt deren Patientenorientierung in den letzten Jahren zu. Es werden zudem leicht verständliche Leitlinien entwickelt, um PatientInnen eine rasche, wissenschaftlich abgesicherte Übersicht zur Entstehung, Diagnostik und Therapie ihrer Erkrankung zu ermöglichen. Es bleibt zu hoffen, dass dieses kostenlose Informationsangebot eine zunehmende Verbreitung in der Bevölkerung erfährt. Derzeit sind entsprechende Apps in Entwicklung, um den Zugriff für PatientInnen noch weiter zu erleichtern.
Aktueller Stand
Gegenwärtig stehen alle Säulen der Naturheilkunde wieder im Fokus des öffentlichen Interesses. Bei der Ernährung gibt es im Bereich Fasten und verschiedenen Ernährungsformen (vegetarisch, vegan, FODMAP etc.) international erhebliches Forschungsaktivitäten, zugleich scheinen die vielen Aufklärungskampagnen hinsichtlich der berechtigten Bedenken bei Qualität, Wirkung und Unbedenklichkeit von Nahrungsergänzungsmitteln bei der Bevölkerung allmählich erfolgreich zu sein. Zur Bewegung wurden in den letzten Jahren sehr viele, zumeist aber wissenschaftlich nicht abgesicherte Apps entwickelt, auch für den Einsatz bei verschiedenen Erkrankungen. Sie sind ohne fachkompetente Begleitung aber wenig brauchbar, der Mangel an geschultem Fachpersonal kann damit nicht ausgeglichen werden. In der Phytotherapie sind aufgrund der weltweiten Forschungsaktivität inzwischen viele klinische Studien durchgeführt worden, diese Belege für ihre Wirksamkeit können über die Patientenleitlinien von der Bevölkerung leicht aufgefunden werden, wodurch Phytotherapie gegenüber kaum oder nicht wissenschaftlich nicht abgesicherten substanzgebundenen Therapien wieder vermehrt Fuß fassen wird. Hydrotherapie und Balneotherapie dürften aktuell aufgrund der Klimakrise und der zunehmenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den Wärme- und Kälterezeptoren eine Renaissance erleben, sie können nämlich, wenn sie richtig angewendet werden, weit mehr als nur Elemente von Wellnesskonzeptionen sein. Schließlich gibt es im Bereich der Entspannungsverfahren sehr viele gut abgesicherte positive Erkenntnisse, insgesamt ist die Mind-Body-Medicine inzwischen sehr vielfältig aufgestellt, so dass esoterische Anteile verzichtbar sind.
Digitalisierung und Naturheilvereine als Chance der Naturheilkunde
Die Zeit für die digitale Vermittlung von gut abgesicherten naturheilkundlichen Inhalten ist längst da. Im Esoterikmilieu wurden die entsprechenden Chancen unter dem Gesichtspunkt der Vermarktung schon lange genutzt. So werben z. B. InfluencerInnen, die mit großer Ausdauer gegen die moderne Medizin wettern und Verschwörungstheorien verbreiten, gleichzeitig am laufenden Band für Nahrungsergänzungsmittel, obwohl bei diesen in der EU alle Aussagen, die sich auf die Beseitigung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten beziehen, verboten sind. Die konkrete Anwendung von wissenschaftlich fundierten naturheilkundlichen Verfahren zur Steigerung des Wohlbefindens kann digital leicht verbreitet werden, hinsichtlich ihres Nutzens für den Einzelnen ist das den üblichen Wohlfühlvideos auf jeden Fall haushoch überlegen. Esoterische Vermenschlichungen von Naturkatastrophen wie z. B. die Erklärung von Hochwasserereignissen als Blockade weiblicher Energien, die zu Wasserstau führt, kommen zwar dem weitverbreiteten Bedürfnis nach einfachen und bequemen Erklärungs- und Bewältigungsmodellen in den gegenwärtigen vielfältigen Krisen entgegen, bieten aber bekanntlich keine reale Hilfestellung. Dagegen kann die expertengestützte Anwendung von Naturheilverfahren, die gezielt durch kreative, leicht zugängliche digitale Botschaften und Ratschläge unterstützt wird, vielfältig insbesondere bei leichteren gesundheitlichen Problemen helfen. Gerade Naturheilvereine sind hervorragend geeignet, der in den letzten Jahren zunehmenden Vereinsamung der Menschen reale Kontakte entgegenzusetzen. Zugleich können die dort organisierten Gesundheits- und Lebensstilexperten den für den Normalbürger undurchdringlichen Dschungel an digitalen Informationen gezielt vorab lichten und dadurch eine große Hilfestellung bieten. Wir müssen jetzt alle aus unseren Pseudokomfortzonen ausbrechen und eigene Initiative zeigen, wenn wir die derzeitigen und noch kommenden Probleme gut bewältigen wollen. Die individuelle bzw. gemeinsame Anwendung von fundierten naturheilkundlichen Verfahren kann uns dabei sehr helfen.
Prof. Dr. Karin Kraft, Vizepräsidentin DNB